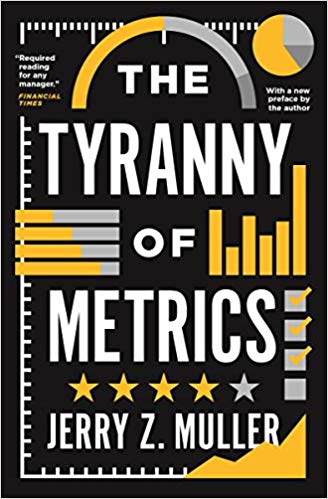Objektiv oder gar wahr wird etwas, wenn es mit Zahlen belegt werden kann. So wird möglichst viel gemessen, ausgewertet und wir sind an numerische Indikatoren unserer Leistung in allen Lebensbereichen gewöhnt. Dabei kennt diese Entwicklung, unterstützt durch die zunehmenden technischen Möglichkeiten, bisher hauptsächlich eine Richtung: Mehr Zahlen. Dieser Entwicklung stellt sich der Historiker Jerry Z. Muller eindrucksvoll entgegen. Er lehrt uns einen vorsichtigen Umgang mit Zahlen, egal in welchem Bereich.
Zur Verdeutlichung möchte ich die Argumente aus Mullers Analyse auf ein Beispiel übertragen:
Vom Wert der Mitarbeiterfortbildung
Viele Unternehmen sind engagiert in der Mitarbeiterfortbildung, aber wie erfolgreich ist sie? Wie genau ermittelt man den Erfolg der Maßnahmen? Eine typische Angabe/Schlagzeile:
Das Unternehmen X hat 2018 2,4 Millionen Euro in Mitarbeiterfortbildung investiert.
Sicherlich eine gute Voraussetzung, denn ohne Investition ist Mitarbeiterfortbildung nicht möglich. Nichtsdestotrotz ist es in erster Linie keine Aussage über den Erfolg der Mitarbeiterfortbildung, denn dieser ist schwierig zu messen. Laut Muller folgt diese Argumentation einem häufig begangenem
Trugschluss: Die Gleichsetzung von Input-Größen mit Outcome-Größen
oder die bewusste Inkaufnahme dieser Gleichsetzung, da die Input-Größen im Vergleich zu den Ausgangsgrößen sehr einfach zu messen sind. Nach dieser Erkenntnis lautet die Forderung von vielen Seiten sogleich: Man muss den Outcome besser in Zahlen abbilden.
Keine Zahlen – keine Wirkung?
Diese Forderung macht eine inhärente Annahme: Alles, was das Unternehmen erfolgreicher macht, ist messbar, oder andersherum formuliert: was nicht messbar ist, kann dem Unternehmen nicht helfen, erfolgreicher zu werden. Eine logische Schlussfolgerung wäre also, dass die Kommunikation zwischen Kollegen keinen Anteil am Unternehmenserfolg hat, da nicht in Zahlen gemessen werden kann, wie viel und über was Kollegen miteinander kommunizieren – gleiches gilt dafür, ob Kollegen sich gegenseitig helfen. Eine Annahme also, die zumindest Zweifel ob ihrer Zulässigkeit aufkommen lässt.
Messung zu teuer?
Natürlich könnte man auch versuchen dies quantitativ zu erfassen, beispielsweise mit Fragebögen, die erfassen, wie häufig man im vergangenen Monat anderen Kollegen geholfen und wie viel Zeit man mit Kollegen geredet hat. Aber vor der simplen Erweiterung der erfassten Daten warnt Muller. Abgesehen von den zusätzlichen Kosten für die Auswertung dieser Daten und die unbezifferbaren Kosten für das Ausfüllen von Fragebögen durch alle Mitarbeiter würde in unserem Beispiel auch völlig unklar sein, welche Anzahl pro Minuten Kommunikation mit Kollegen pro Monat zuträglich ist, insbesondere da diese Metriken typischerweise projektabhängig sind.
Wenn die Messung den Messenden verändert
Ein weiterer, immer wieder auftretender Effekt bei der Erfassug von Performance-Indikatoren, die nicht anonymisiert sind und somit über Karriere und Gehalt oder Boni entscheiden, ist die Reaktion der betroffenen Personen. Anders als in den Natur- oder Ingenieurswissenschaften, wo sich das Messobjekt grundsätzlich
erstmal nicht an die Messung anpasst (einmal abgesehen von der Quantenphysik), reagieren Menschen auf die Messung und ändern somit das Ergebnis. Die Erfassung der Kommunikationsminuten zwischen Mitarbeitern kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter weniger unterhalten, als für ein bestimmtes Projekt notwendig ist. Oder aber es führt gleich dazu, dass die Daten geschönt werden; ein weiteres typisches Problem, das auftritt, sobald die erfassten Zahlen zur Bewertung von Arbeitsleistung verwendet werden.
Wie aus dem Teufelskreis ausbrechen?
Die Lösung für diese Art von Teufelskreis sieht Muller in einem größeren Fokus auf die eigentlichen Tätigkeiten aller Mitarbeiter statt einer zunehmenden Zahlenerfassung, mehr Vertrauen in den Willen aller, unter guten Bedingungen auch bestmögliche Arbeit zu leisten und der qualitativen Analyse von langjährigen Experten zur Bewertung von Performance. Dabei betont er, dass er eine quantitative Erfassung von Daten für durchaus nützlich hält, wenn sie denn unter den richtigen Bedingungen erfolgt.
Muller fordert einen sauberen Umgang mit Zahlen
Diese und viele weitere, zum Umdenken anregende Argumente bringt Muller in seinem knapp 300 Seiten langen Buch vor und begründet diese wissenschaftlich sauber und qualitativ hochwertig. Dabei zitiert er Beispiele aus verschiedenen Bereichen, insbesondere aus dem Bildungssektor und staatlichen Institutionen, aber auch aus der freien Wirtschaft. Durch eine extrem verkürzte Darstellung der Gegenpositionen schafft Muller es, das Buch kurzweilig zu halten, nimmt dabei aber eine einseitige Darstellung in Kauf. In seinem Abschlusskapitel wechselt Muller von der weitestgehend analytischen Rolle in eine schaffende Rolle, in der er eine Checkliste zur Vermeidung von typischen Fehlern bei der Erfassung und Analyse von Daten entwickelt. Insgesamt bezieht sich das Buch wesentlich auf Studien in den USA und Großbritannien, die daher in manchen Gegebenheiten deutlich von den typischen hiesigen Gegebenheiten abweichen. Nichtsdestotrotz lassen sich viele der Beispiele direkt in den Alltag übertragen und die urchdachte Argumentation lässt zumindest Zweifel an der immer stärker werdenden Fokussierung auf quantitative statt qualitative Merkmale aufkommen.